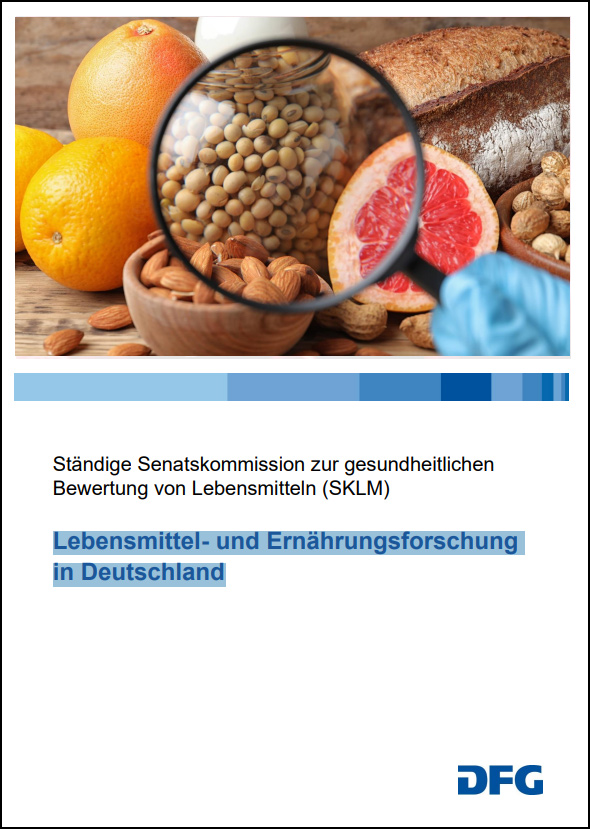Herr Dr. Munz, wie wichtig ist Forschung und Entwicklung für den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Ernährungsindustrie?
Dr. Munz: Sehr wichtig und in doppelter Hinsicht: Forschung und Entwicklung helfen der deutschen Ernährungsindustrie in den unterschiedlichsten Bereichen noch besser zu werden bzw. Neuland zu erschließen; sei es beim Einsatz neuer Technologie, der energieeffizienten Produktion, der Erschließung neuer Rohstoffquellen oder der Optimierung der Produktqualität. Nicht ohne Grund sind auch Themen der Lebensmittelforschung Teil der kürzlich vorgestellten Hightech Agenda Deutschland.
Durch Forschung und Entwicklung werden gleichzeitig die zukünftigen Fach- und Führungskräfte der deutschen Lebensmittelindustrie ausgebildet.
Welche Themenfelder bestimmen aktuell die Forschungsarbeit im FEI?
Dr. Munz: Der FEI hat keine eigene Agenda, sondern bedient die Forschungsbedarfe der deutschen Lebensmittelindustrie. Nach wie vor ist die ressourcenschonende Produktion ein wichtiges Thema. Dies umfasst einerseits das Thema Energie andererseits die Nutzung von Rest- und Nebenströmen. Ebenfalls von Bedeutung ist die Entwicklung von Lebensmitteln mit einem gesundheitlichen Mehrwert bzw. Forschung zum vorbeugenden Verbraucherschutz.
Wie unterstützt der FEI konkret dabei, Forschung anzuregen, zu koordinieren und Ergebnisse in die Praxis zu bringen?
Dr. Munz: Der Forschungskreis der Ernährungsindustrie ist die zentrale Forschungsvereinigung der deutschen Lebensmittelwirtschaft in all ihren unterschiedlichen Branchen. Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Förderung praxisorientierter Lebensmittelforschung. Der FEI agiert dabei als Plattform, auf der die Forschungsbedarfe der Lebensmittelindustrie und die Forschungskapazitäten der deutschen Lebensmittelforschung zusammengeführt werden. Im Idealfall entstehen so Projekte, die dann im Programm der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördert werden können.
Wie groß ist das Fördervolumen, das der FEI jährlich bewegt?
Dr. Munz: Der FEI wirbt jährlich ca. 25 neue Projekte im IGF-Programm ein. Insgesamt werden ca. 100 laufende Projekte betreut. In diese fließen über den FEI jährlich Mittel in Höhe von rund 10 Millionen Euro.
Können Sie Beispiele nennen, wie IGF-Projekte konkret zu einer Verbesserung in der Praxis geführt haben?
Dr. Munz: IGF-Projekte sind anwendungsorientierte und vorwettbewerbliche Forschungsprojekte. An der Durchführung der Projekte sind von Anfang an Interessierte aus den beteiligten Firmen im sogenannten Projektbegleitenden Ausschuss beteiligt. Das im Projekt generierte Wissen steht somit allen zur Verfügung und wird veröffentlicht. Es kommt also einer ganzen Branche zugute. Wie es dann wettbewerblich in den einzelnen Firmen genutzt wird, ist uns nicht immer bekannt.
 Quelle: FEI - Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V.
Quelle: FEI - Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V.Gibt es ein Projekt oder eine Innovation, auf die Sie besonders stolz sind?
Dr. Munz: Selbstverständlich. Das sind beispielsweise jene, die es in die jährliche Endrunde zur Prämierung des IGF-Projektes des Jahres geschafft oder diese sogar gewonnen haben. Näheres zu diesen Projekten findet sich auf unsere Homepage. Zu nennen sind hier beispielsweise das Projekt Oleoboost – Regionale Pflanzenöle als Palmölersatz oder der Cereulid-Nachweis für vorbeugenden Verbraucherschutz. In letzterem wurde ein Schnellnachweis und ein Echtzeit-Monitoring für das Toxin Cereulid in Lebensmitteln entwickelt, auf dem ein inzwischen weltweit angewandter ISO-Standard zur Cereulid-Quantifizierung basiert.
Sie haben darauf hingewiesen, dass die Lebensmittelforschungslandschaft fragil ist. Woran liegt das und was braucht es für Zukunftssicherheit?
Dr. Munz: Die deutsche Lebensmittelforschungslandschaft ist sehr kleinteilig und interdisziplinär. Der FEI als einer der wichtigsten Förderer hat 2024 100 Projekte an 47 Forschungsinstituten bzw. 31 Forschungsinstitutionenbetreut. 40% der Projekte haben einen ingenieurswissenschaftlichen bzw. einen lebensmittelchemischen Kontext, die verbleibenden 20% kommen aus den Lebenswissenschaften, vor allem der angewandten Mikrobiologie und der Hygiene. Kaum einer der Forschungsstandorte verfügt über die kritische Masse, alle diese Expertisen abzudecken. Dies wird aber nötig sein, um wissenschaftlich kompetitiv und als Studienort attraktiv zu bleiben. Ich plädiere daher für den Erhalt bzw. die Schaffung entsprechender Zentren der Lebensmittelforschung. Dies umfasst einerseits eine entsprechende Anzahl an Professuren und andererseits eine entsprechende Infrastruktur. Es ist naheliegend, dass nicht alle 31 Forschungsinstitutionen dies leisten können, sondern eher fünf bis zehn.
Würden Sie empfehlen, Forschungsressourcen stärker zu bündeln, selbst wenn das bedeutet, kleinere Standorte aufzugeben?
Dr. Munz: Ja. Allerdings liegt dies nicht in der Zuständigkeit der Fördermittelgeber, sondern bei der GWK, der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Alternativ zu einem Top-Down-Ansatz durch die GWK käme auch ein Wettbewerb in Frage, in dem die einzelnen Forschungsinstitutionen darlegen, wie sie diesen Bereich zukünftig aufstellen möchten. Die Fördermittelgeber könnten dann die besten Konzepte finanzieren. An einem solchen Prozess sollte sich selbstverständlich die deutsche Lebensmittelindustrie in angemessener Weise beteiligen, sei es durch die Unterstützung einzelner Standorte oder des Wettbewerbs insgesamt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kommt zu einer ähnlichen Einschätzung und hat diese 2024 im Positionspapier Lebensmittel- und Ernährungsforschung in Deutschland veröffentlicht.
Wie gefährdet ist die Forschungslandschaft in Deutschland angesichts knapper Budgets?
Dr. Munz: Wir werden sicherlich deutliche Veränderungen in den nächsten Jahren sehen. Dies liegt aber primär in der schwierigen Grundfinanzierung der Lehrstühle durch die Länder. Forschungsgelder der diversen Drittmittelgeber hingegen sind immer projektbezogen. Sie finanzieren keine Professur oder Institute, sondern ergänzen eine entsprechende Grundfinanzierung. Es liegt daher primär in der Hand der Länder für den zielgerichteten Erhalt bzw. Ausbau einzelner Standorte zu sorgen. Die kompetitive Einwerbung von Drittmitteln kann dabei ein Indikator neben anderen sein.
Wie können Verbände wie die BVE und ihre Mitgliedsunternehmen dazu beitragen, Wirtschaft und Forschung noch enger zu verzahnen?
Dr. Munz: Dem Forschungskreis gehören durch direkte Mitgliedschaft sowie über 45 Wirtschaftsverbände und Branchenorganisationen rund 6.000 Unternehmen der deutschen Lebensmittelindustrie sowie über 30.000 Betriebe des Lebensmittelhandwerks an. 2024 haben sich in den Projektbegleiteden Ausschüssen über 1000 unterschiedliche Firmen engagiert. Der FEI ist daher ein bekannter und etablierter Akteur. Selbstverständlich freuen wir uns über neue Mitglieder, die den Verein nicht nur projektbezogen unterstützen.
Die Verzahnung in den IGF-Projekten und darüber hinaus im FEI bzw. an den jeweiligen Forschungseinrichtungen ist gut. Diesen Zustand gilt es zu erhalten. Entscheidend hierfür ist es, immer wieder auf die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für die Wirtschaft hinzuweisen und einerseits die entsprechenden Institute und Lehrstühle, andererseits aber auch die entsprechenden Förderprogramme zu erhalten.
Müssen sich die Hersteller hier stärker finanziell engagieren?
Dr. Munz: Die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft engagieren sich im Rahmen der diversen Förderprogramme wie dort gefordert. Das erscheint mir ausreichend. Wie oben erwähnt, muss die Branche aber systemisch darauf hinwirken, dass die Forschungslandschaft insgesamt existent und wettbewerbsfähig bleibt. Hier sehe ich eher die jeweiligen Verbände gefordert.
Wettbewerbe wie Trophelia Deutschland, den das FEI in Deutschland durchführt, fördern kreative Köpfe an Hochschulen. Wie gelingt es, ausreichend Nachwuchs für Forschung und Industrie zu gewinnen?
Dr. Munz: Sichtbarkeit und Attraktivität wäre hier meine Antwort. Das Thema Lebensmittel und Ernährung ist prinzipiell positiv besetzt und für viele interessant. Die entsprechenden Studienstandorte müssen ihre Angebote national und international sichtbar und attraktiv bewerben. Dies gelingt besonders dann, wenn man in diesen Bereich gut aufgestellt ist und die Unterstützung auf Leitungsebene hat.
Vielen Dank für das Interview!
>> Download der DFG-Publikation „Lebensmittel- und Ernährungsforschung in Deutschland“